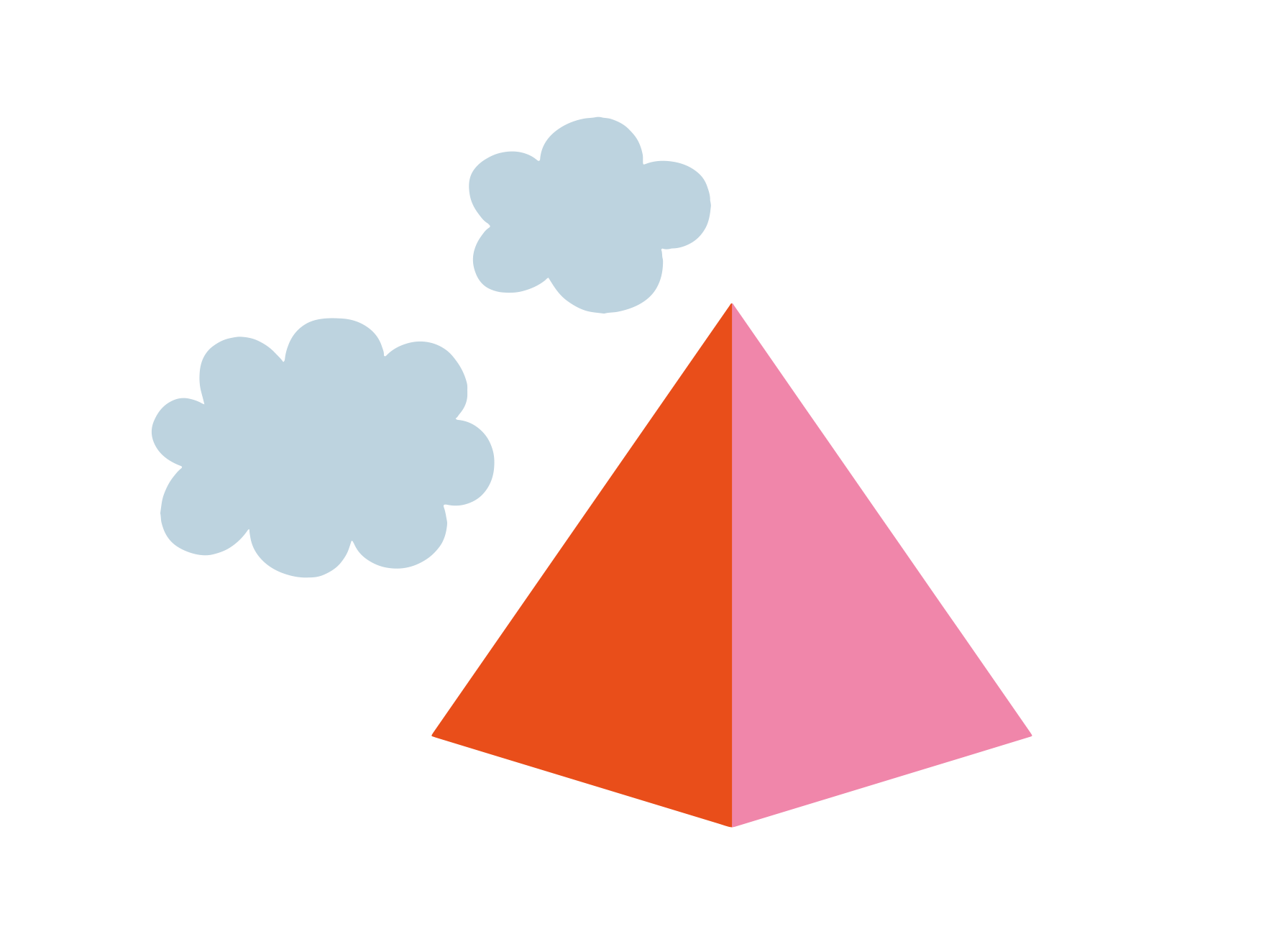„Guter Hoffnung sein“ – dies war einst ein gängiges Synonym für Schwangerschaft. „Ich bin guter Hoffnung“ – das hieß, „ich blicke mit Optimismus und Zuversicht auf das Leben, das in mir wächst und auf dessen Ankunft ich mich freue“ und implizierte gleichzeitig die Möglichkeit, dass es auch anders ausgehen könnte – in einer Zeit, in der die Wahrscheinlichkeit, dass Mutter oder Kind das Ereignis der Geburt nicht überleben, um ein Vielfaches höher war als heute.
„Guter Hoffnung sein“ – das klingt nach Schicksalsergebenheit und passt so gar nicht in die heutige Zeit, in der Machbarkeit und Kontrolle unsere Entscheidungen und unser Handeln bestimmen und die technischen Möglichkeiten uns suggerieren, wir hätten alles Griff. Wenn man Schwangere fragt, warum sie sich fraglos den angebotenen vorgeburtlichen Untersuchungen unterziehen, antworten Sie nicht selten „Ich will, dass mein Kind gesund ist“. Der pränataldiagnostische „Aktionismus“ in den Frauenarztpraxen greift dieses Bedürfnis auf und erzeugt es gleichzeitig – ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der keinen Raum lässt für Fragen, wie „Was möchte ich mit der Untersuchung herausfinden?“ „Welche Konsequenzen könnte ein entsprechender Befund für mich haben?“ und „Welche Entscheidung müsste ich dann treffen und wäre ich dazu bereit und in der Lage?“
Dahinter steht die grundsätzliche Frage nach der Haltung dem werdenden Leben gegenüber. Was haben wir für Erwartungen an das Kind? Welche Wünsche und Hoffnungen sind damit verbunden, welche Befürchtungen? Und können wir akzeptieren, dass das Kind vielleicht ganz anders ist, als in unseren Vorstellungen? – vielleicht entwickelt es sich langsamer, ist anfällig für Krankheiten, körperlich behindert oder geistig zurückgeblieben.
Bis zu dieser Frage kommt es meist gar nicht, da wir ja glauben, diese Möglichkeiten durch rechtzeitige Diagnostik ausschließen zu können, bzw. bei entsprechendem Befund das Kind erst gar nicht zur Welt bringen. „Das ist doch heutzutage nicht mehr nötig!“ ist denn auch ein Ausspruch, den sich vor allem Eltern von Kindern mit Behinderungen aufgrund einer genetischen Anomalie anhören müssen. Und es stimmt ja: Mit dem seit einigen Jahren auf dem Markt befindlichen Praenatest lässt sich das Down Syndrom bereits in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten schnell und nebenwirkungsfrei ermitteln. Die Abbruchquote nach Befund liegt bei über 90 Prozent, ist also nahezu eine Selbstverständlichkeit. Wer sich dennoch für das Kind entscheidet, gehört damit zu einer Randgruppe.
Spätestens an der Stelle stellt sich die Frage danach, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen und welches Leben wir als lebenswert erachten. Und das ist keine Frage, mit der wir werdende Eltern alleine lassen sollten. Diese brauchen zu Beginn vor allem solide Informationen über Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik, nach einem Befund eine professionelle und ergebnisoffene Beratung und eine liebevolle Begleitung für die Zeit nach der Entscheidung für oder gegen das Kind, egal, wie sie ausgeht. Unsere Gesellschaft hingegen braucht dringend eine breite Debatte darüber, nach welchen Kriterien wir Leben und Zusammenleben angesichts der biomedizinischen Möglichkeiten bewerten, planen und organisieren wollen – und das ist vor allem eine ethische Frage.
Auf www.schwanger-in-karlsruhe.info/praenataldiagnostik-beratung.php gibt es eine Übersicht zu Beratungsstellen, Arztpraxen mit Schwerpunkt Pränataldiagnostik bzw. Humanmedizin und Seelsorgern.