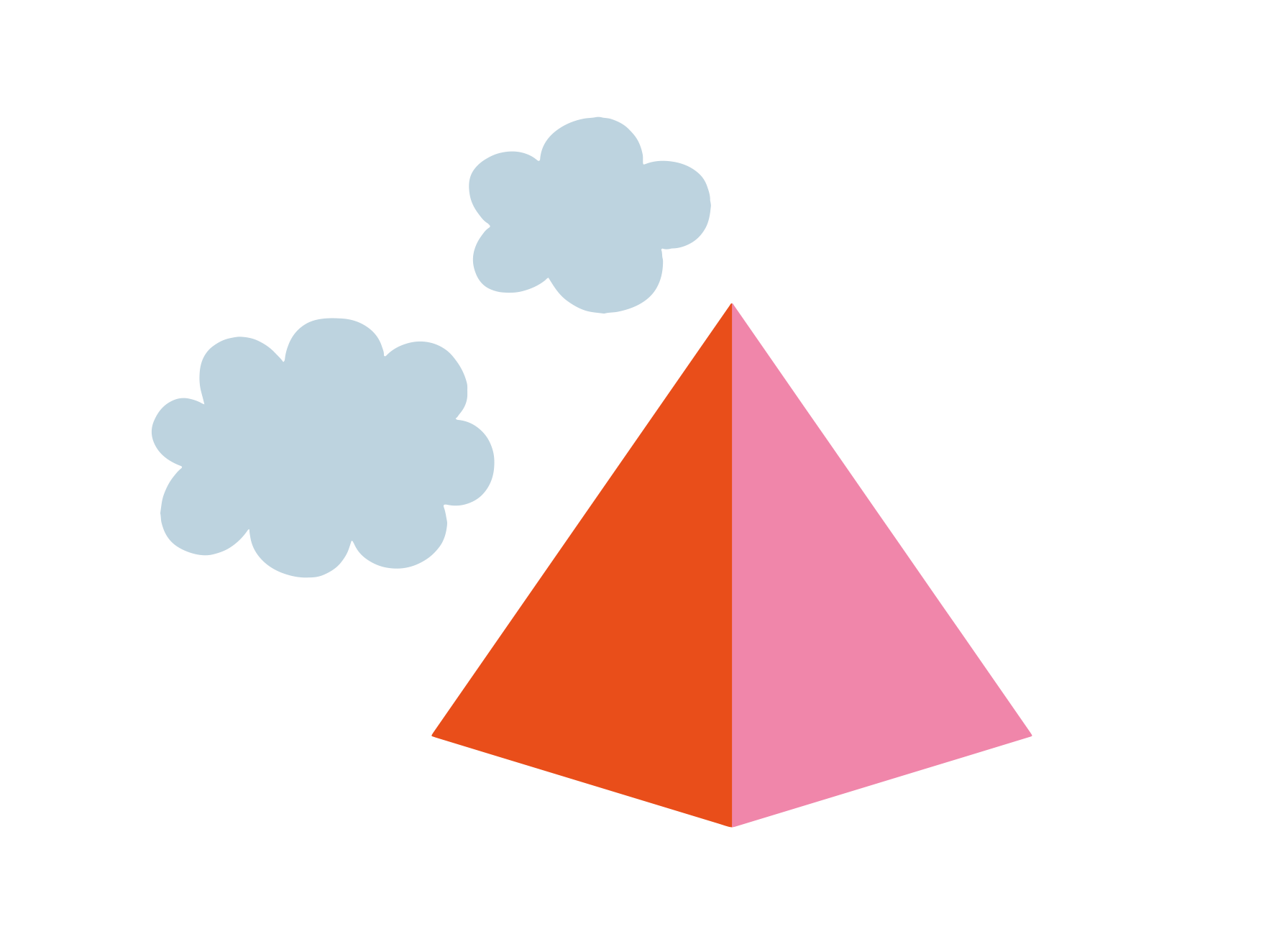Sich in die Augen schauen heißt sich verbinden. Über die Augen nehmen wir Kontakt auf, erspüren wir die Verfassung des anderen, fühlen wir uns gesehen.
Woher kommt das?
Neben der Wahrnehmung über die Haut sind die Augen ein weiteres Sinnesorgan, das Säuglingen einen Kontakt zur Mutter und damit zu sich selbst ermöglicht. Zu Beginn unseres Lebens unterscheiden wir noch nicht zwischen ICH und DU. Die Mutter wird als Teil des eigenen Ichs erlebt, als „Erweitertes Ich“. Fehlt dem Kind etwas (und schreit es deshalb), hat es in den ersten Monaten noch keine Vorstellung, was genau fehlt oder was es braucht. Es ist darauf angewiesen, dass dies durch andere erkannt und beruhigt wird.
Im Spiegeln der Mutter lernt es Schritt für Schritt unterschiedliche Gefühle und Bedürfnisse als solche zu erkennen und auch Worte dafür zu haben. „Du bist müde und brauchst Schlaf.“ „Du hast Dich erschreckt und brauchst Trost.“ Ist dies verbunden mit ansehen, einfühlsamer Stimme und adäquater Handlung (in den Schlaf wiegen, trösten, zu essen geben …) stellt sich bei dem Kind Sicherheit ein. Diese Sicherheit muss immer wieder neu erlebt werden, da das Kind Erfahrungen noch nicht in die Zukunft projizieren kann, es lebt im Hier und Jetzt. Geht die Mutter aus dem Zimmer, ist sie weg. Dass sie gleich wieder kommt, muss wiederholt erlebt werden. Erst im zweiten Lebensjahr, meist mit 18 Monaten kann das Kind die Vorstellung entwickeln, meine Mutter ist nebenan. Durch die gleichzeitige Sprachentwicklung hat es nun die Möglichkeit, zu rufen oder durch Reden in Kontakt zu bleiben. Parallel entwickelt sich die Möglichkeit, sich über eigene positive Vorstellungen, mit sich reden, mit der Puppe reden usw. sich selbst zu beruhigen. Dies sind die Grundlagen für unsere spätere Fähigkeit Beziehungen zu gestalten, auch zu unseren eigenen Kindern.
Wie gelingt es meinem Kind trotz Stress eine verlässliche Spiegelung zu sein?
Die Hilflosigkeit des Kindes kann uns an unsere eigene Bedürftigkeit heranführen. Das heißt die Spiegelung dreht sich und ich als Erwachsene spiegele mich in den Augen des Kindes. Schreit das Kind, bin ich gestresst – weil ich mich wieder mit der Ohnmacht verbinde, die ich selbst erlebt habe. Im Extremfall werde ich blind für die tatsächlichen Bedürfnisse des Kindes. Dann wäre es gut, sich Unterstützung zu holen. Im Normalfall gibt es Reaktionen von Unsicherheit und die Angst etwas falsch zu machen.
Was wäre angesichts dessen hilfreich?
- Das Schreien ist die (einzige) Sprache des Babys und ich versuche, mich nicht davon anstecken zu lassen.
- Ich bin da. Atme durch. Spüre mich. Erde mich.
- Dadurch bleibe ich mit mir im Kontakt.
- So bleibe ich auch im Kontakt mit dem Kind. Sehe es an, berühre es.
- Ich bin erwachsen, ich bin nicht hilflos, sondern kann mich erinnern, was das letzte Mal half oder ausprobieren, was das Kind brauchen könnte.
- Ich muss nicht perfekt sein.
- Ich darf dem Kind und mir vertrauen.
- Wir lernen miteinander, wie es geht. Es ist ein Prozess.
… und nachher gibt es wieder eine kleine Pause, in der ich Kraft tanken kann.
Vielleicht finden Sie selbst, liebe Leser*innen weitere Sätze, die Ihnen helfen oder in der
Vergangenheit geholfen haben?
Vieles von dem, was hier beschrieben ist, lässt sich auf die Vater-Kind-Beziehung übertragen. Auch da geht es um Spiegeln, im Kontakt mit dem Kind sein, Selbst- und Kindwahrnehmung.
Text: Barbara Fank-Landkammer & Magdalena Hochweis-Müller